Teilprojekte im TSC2 +/- (Eker)-Tiermodell, Projekt ID 0415
Projektleiter: Privatdozent Dr. med. Robert Waltereit, Medizinische Fakultät Carl Gustav Cars, Technische Universität Dresden, in Kooperation mit dem Nationalen Institut für Seelische Gesundheit der Tschechei NUDZ Klecany, Prag
Kurzfassung
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll während einer Behandlung von TSC2+/--Eker-Ratten mit Everolismus eruiert werden, ob ein positiver Einfluss des Everolismus auf die häufig mit TSC in Verbindung stehende Autismus-Spektrum-Störung besteht.

Laufzeit
Das Projekt soll voraussichtlich im August 2018 abgeschlossen werden.
Fördermittel
Die Deutsche Tuberöse Sklerose Stiftung unterstützt das Projekt mit einem Förderbetrag in Höhe von 10.000,- €.
Priv.-Doz. Dr. med. Robert Waltereit

Projektbeschreibung
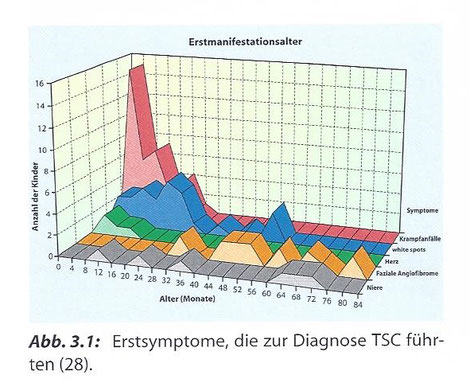
Autismus ist eines der häufigsten Symptome der an TSC erkrankten Personen. Nach derzeitigem Forschungsstand dürfte bei rund 40 bis 50 % der TSC-Betroffenen eine Störung aus dem Formenkreis des Autismus vorliegen. Er zeigt sich bei etwa einem Viertel aller Betroffenen bereits im frühkindlichen Alter.
Die Forschung geht heutzutage davon aus, dass der Autismus in erster Linie eine erblich bedingte Ursache hat. Im Rahmen der bisherigen TSC-Forschung konnte aber darüber hinaus festgestellt werden, dass ein erhöhtes Risiko hierfür besteht, wenn bei dem an TSC-Erkrankten zusätzlich eine Intelligenzminderung existiert und/oder sich eine Vorgeschichte von Epilepsie findet.
Ungefähr 65 % der TSC-Patienten entwickeln nämlich eine Epilepsie. Dies liegt darin begründet, dass bei der TSC das Gehirn als Teil des zentralen Nervensystems besonders häufig betroffen ist und sich hierdurch meist schwerwiegende Folgen in seiner Funktion ergeben.
Grundüberlegung dieses Forschungsprojektes ist daher, dass man mit einer speziellen Behandlung der Epilepsie die Autismus-Spektrum-Störung positiv beeinflussen könnte. Hierbei soll der Wirkstoff „Everolismus“ zum Einsatz kommen, welcher bereits in einigen Studien für unterschiedliche Krankheitsmerkmals der TSC positiv getestet wurde und zwischenzeitlich für einige TSC-Merkmale als Medikament zugelassen ist, wie beispielsweise zur Behandlung von Riesenzellastrozytomen (SEGA, mehr oder minder schnell wachsende gutartige Tumoren im Gehirn), sowie Angiomyolipomen, etc. Zuletzt - im Februar 2017 – wurde der Everolismus nun auch für die Anwendung als Begleittherapie bei TSC-Patienten ab 2 Jahren mit ansonsten therapieresistenten partiellen Krampfanfällen (Epilepsie) zugelassen, wodurch einem erheblichen Teil der Patienten sehr geholfen werden kann.

„Everolismus“ verfügt über einen mTOR-hemmenden Effekt, welcher dem eines gesunden TSC1-TSC2-Effekts entspricht. Normalerweise wird in den Zellen durch die im TSC1-Gen und im TSC2-Gen vorhandenen Geninformationen zur Bildung der Eiweiße Hamartin (im TSC1-Gen) und Tuberin (im TSC2-Gen) der sog. Hamartin-Tuberin-Komplex gebildet, welcher die Aktivität des Proteins mTOR (mammalian Target of Rapamycin) hemmt. Dieser Vorgang ist bei Vorliegen einer TSC-Erkrankung gestört. Der Wirkstoff „Everolismus“ greift genau an dieser Stelle und demnach in einen grundlegenden molekularen Mechanismus ein, was den Wissenschaftlern Anlass zu der Überlegung gibt, dass sich mit diesem Wirkstoff evtl. noch weitere Symptome des Krankheitsbildes TSC behandeln lassen könnten.
Aus diesem Grunde hat sich eine Gruppe Wissenschaftler/innen unter Leitung von Herrn Privatdozent Dr. Robert Waltereit in Deutschland und der Tschechei zusammengeschlossen, welche bereits in der Vergangenheit entsprechende Studien durchgeführt haben. Im hier geförderten Projekt wird an Eker-Ratten, welche eine TSC2+/- -Mutation tragen, als auch an nichtmutierten Wild-Typ Ratten, die dem Vergleich dienen, künstlich eine Epilepsie erzeugt. Anschließend werden sie mit „Everolismus“ behandelt. Danach wird ihr Verhalten über längere Zeit hinweg beobachtet. Das Augenmerk wird dabei besonders auf mögliche Veränderungen des autistischen Verhaltens, sowie auf die einzelnen Behandlungsfaktoren (TSC2+/--Mutation und Epilepsie) gerichtet. Man erhofft sich hierdurch eine positive Veränderung des Status Quo. Sollte dies der Fall sein, also könnten Zusammenhänge zwischen der TSC2+/--Mutation, der Epilepsie, dem Autismus und der Wirkung von „Everolismus“ erkennbar sein, dann dürfte damit ein Grundstein für die effizientere Behandlung des autistischen Verhaltens von TSC-Patienten gelegt sein.
Grundlagenwissen

Unter Autismus wird eine tiefgreifende und schwere Störung in der Kommunikation und sozialen Interaktion mit anderen Menschen verstanden, welche nicht als Folge einer anderen Störung auftritt, sondern meist von Geburt an besteht. Darüber hinaus liegen oftmals stereotype oder ritualisierende Verhaltensweisen vor.
Die Betroffenen verarbeiten Sinneseindrücke ganz anders als gesunde Personen. Außerdem unterscheiden sie sich sehr stark in ihrer Wahrnehmung und Intelligenz.
Autismus muss nicht unbedingt von Geburt an auftreten. Er kann sich auch erst ab dem dritten Lebensjahr manifestieren. Wissenschaftlich gesichert ist heute die Tatsache, dass Autismus keine Folge falscher Erziehung oder Zuwendung oder ähnlichem ist, sondern er erblich bedingt ist. Es gibt ihn in unterschiedlicher Ausprägung, wie z. B. auch in atypischer oder in Form des Asperger-Syndroms.
Bei Epilepsie (griechisch „epilepsia“ Fallsucht) handelt es sich um eine Funktionsstörung des Gehirns, welche durch wiederholte epileptische Anfälle charakterisiert ist. Ist sie durch Hirnveränderungen, wie beispielsweise Tumoren, gekennzeichnet, dann wird dies als symptomatische Epilepsie bezeichnet. Dies ist bei TSC-Patienten typischerweise der Fall, weil ihre Hirnrinde meist höckerartige Veränderungen (Sog. Tubera) aufweist.
Ausführliche Hinweise zum Autismus bei TSC finden Sie im Informationsblatt Nr. 11 des Tuberöse Sklerose Deutschland e. V. und zu epileptischen Anfällen bei TSC im Informationsblatt Nr. 17 des Tuberöse Sklerose Deutschland e. V., welche Sie unter www.tsdev.org bestellen bzw. downloaden können.
Wie bereits im Basiswissen des Forschungsprojektes „Next Generation Sequencing“ erläutert wurde, gehören Hamartin und Tuberin zu einem TSC-Proteinkomplex. Dieser stellt einen negativen (hemmenden) Regulator des sog. mTOR-Signalweges (mammalian Target of Rapamycin) im Zellplasma dar. Folglich wird bei einem Ausfall des TSC1/TSC2-Komplexes die sog. mTOR-Signaltransduktion (von latein. traductio = Hinüberführung, also Genübertragung) aktiviert, was zu einer vermehrten Zellteilung und fehlerhaften Differenzierung führt.
Rein zufällig wurde im Jahr 1975 der Wirkstoff „Rapamycin“ von Claude Vezina, S.N. Sehgal und Mitarbeitern in einer Bodenprobe von der Osterinsel, die vom Rano Kao stammte, entdeckt.
In der klinischen Forschung wurde danach herausgefunden, dass die Aktivierung der Zellteilung und der Differenzierung durch sog. mTOR-Inhibitoren, wie Rapamycin (Sirolismus, Rapamune ®) und dessen Derivat RAD001 (Everolismus, Afinitor ®, Votubia ®), gehemmt werden kann. Es fehlen jedoch noch entsprechende Langzeitstudien über die möglichen Konsequenzen.
Einzelne Teilaspekte dieser möglichen Konsequenzen, wie positiver Einfluss auf Störungen des Lernens und des Sozialverhaltens konnten bereits durch Versuche mit sog. TSC1- und TSC2-Knockout-Mäsuen untersucht werden.
Weiterreichende Hinweise zu dieser ersten Versuchsreihe finden Sie auf der Homepage des Tuberöse Sklerose Deutschland e. V. (http://www.tsdev.org/deutsch/625/191/182/92001/design2.html).
Bei den sog. Eker-Ratten, welche im vorliegenden Forschungsprojekt verwendet werden, handelt es sich um Tiere, welche bereits eine Mutation im TSC2+/--Gen aufweisen. Diese werden speziell für diese Versuche gezüchtet. Sie werden während sämtlicher Versuchsreihen immer mit nichtmutierten Wild-Typ Ratten verglichen, so dass auch eine Wirkung auf gesunde Tiere beobachtet werden kann.
Bereits in den ersten Versuchsreihen vor unserem Forschungsprojekt konnte in diesen Vergleichen festgestellt werden, dass es mit der künstlich erzeugten Epilepsie zu deutlichen Defiziten im Sozialverhalten kam.
Bekanntermaßen kann aus den Versuchsergebnissen keine 1:1-Übertragung auf den Menschen erfolgen, jedoch haben diese eine gewisse Aussagekraft, welche anschließend durch Tests mit Menschen überprüft werden müssen.
Kooperations-Wissenschaftler am NUDZ in Prag


